Bereits seit einigen Jahren berät die HarzOptics GmbH auf Basis der Beleuchtungsnorm DIN EN 13 201 Kommunen und kommunale Energieversorger bei der Renovierung und Neustrukturierung ihrer Beleuchtungsanlagen. Hierbei kommt neben dem Lichtplanungstool DIALux auch das Open Source-Geoinformationssystem QGIS (Quantum GIS) zum Einsatz. Wie ein solches Projekt üblicherweise abläuft, wollen wir heute einmal kurz anhand der drei zentralen Projektphasen darstellen.
Phase 1: Erfassung der IST-Situation und Aufbau des Lichtpunktkatasters
Zu Beginn einer neuen Beleuchtungsplanung müssen wir uns zunächst einmal einen umfassenden Überblick über die bestehende Beleuchtungssituation verschaffen. Da in vielen – nicht aber in allen – Kommunen ein Lichtpunktkataster fehlt, ist diese Phase meist die zeitaufwändigste. Dabei wird mit Hilfe von GPS-Geräten der Standort jedes Lichtpunkts auf etwa 10 cm genau eingemessen und aus den erhobenen Daten eine Lichtpunktkarte in QGIS generiert. Im Rahmen dieser Einmessung werden auch weitere Informationen über die existierende Beleuchtung erhoben, so etwa Lampen- und Leuchtentyp, sichtbare Beschädigungen oder – bei Nachteinmessungen – die Lichtstärke in Lux auf Augenhöhe des Normalbeobachters unter dem Lampenkopf. Auf diese Weise entsteht nicht nur eine einfache Lichtpunktkarte, sondern ein vollständiges Lichtpunktkataster als weitere Planungsgrundlage.
Zur Erfassung der IST-Situation gehört außerdem die Erhebung weiterer Daten mit Relevanz für die folgende Planung nach der DIN EN 13 201. Befinden sich zum Beispiel in einer Straße Fußgängerüberwege oder Ampeln? Ist das Parken an den Straßenrändern gestattet? Wird eine Straße primär durch PKW oder auch durch Lastwagen oder Radfahrer befahren? Gibt es in einer Straße Schulwege, Schulen, Kitas, Krankenhäuser oder historische Unfallschwerpunkte? Und so weiter und so fort… Alle diese Informationen finden Eingang in Kataster und Karte und dienen damit als weitere Planungsgrundlage.
Phase 2: Analyse der IST-Situation und Aufstellung der Ziele für den SOLL-Zustand
Wurden alle erforderlichen Daten erhoben, geht es im nächsten Schritt nun an deren Auswertung. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Auswertung ist die Klassierung der Straßen nach der DIN EN 13 201, die auf Basis der vorliegenden Daten zu Verkehrssituation und Verkehrsdichte erfolgt. Mit der für jede Straße einzeln zu ermittelnden Beleuchtungsklasse wird festgelegt, welche Beleuchtungsstärke hier zu erreichen ist – damit steht wiederum der wichtigste Parameter für die Planung des SOLL-Zustands fest (wenn sich die Kommune denn wirklich starr an den nicht immer optimalen Vorgaben der DIN orientieren möchte, siehe hierzu auch den Kommentar weiter unten).
Nicht selten ergeben sich die ersten Optimierungspotentiale in dieser Phase praktisch von alleine. So kann etwa auf helle Beleuchtung in Anliegerstraßen ohne viel Verkehr oder in leergezogenen Industriebrachen leicht verzichtet werden – ebenso wie auf von Baumkronen umwachsene Leuchten, deren Licht so gut wie vollständig „geschluckt“ wird, oder auch auf Leuchten, die so ausgerichtet sind, dass sie unmittelbar in die Fenster von Privatwohnungen strahlen. Viele dieser Probleme lassen sich ohne größeren Aufwand durch den Rückbau überflüssiger Beleuchtung oder durch eine simple Neuausrichtung von Leuchten beheben – in diesen Fällen muss nicht in neue Technik investiert werden und es ergeben sich oft unmittelbare energetische Einsparungen. Da viele kommunale Entscheider eine Analyse ihrer Straßenbeleuchtung scheuen, weil sie befürchten, dass ihnen im Ergebnis eine nahezu unbezahlbar teure Investition in moderne (LED-) Beleuchtung vorgeschlagen wird, bieten wir Kommunen stets gerne an, erst einmal mit der Suche nach Einsparpotentialen zu beginnen und zunächst einige Einsparungen zu realisieren, bevor in der Folgezeit dann ein schrittweiser Umbau der tatsächlich noch erforderlichen Beleuchtung auf energieeffizientere Technik erfolgt.
Die im Rahmen dieser Phase entstandene Lichtpunktkarte kann außerdem – falls die Kommune noch über kein eigenes GIS verfügt sogar samt QGIS – an den Auftraggeber übergeben werden und zukünftig als Instrument für die Fortschreibung der Lichtplanung dienen (Bonus: Sensibilisierung der Kommune für die Vorteile des Einsatzes von Open Source-Software). Idealerweise sollte die Übererfüllung des Beleuchtungsbedarfs (z.B. durch den Wegzug aus einem Quartier oder die Verringerung der Verkehrsdichte) bei kontinuierlicher Fortschreibung einer solchen Lichtplanung zukünftig frühzeitig erkannt werden, so dass ein schneller Rückbau nicht mehr erforderlicher Beleuchtung erfolgen kann – die entstandende Lichtpunktkarte entfaltet also nicht nur einen Nutzen für die unmittelbar anstehende Beleuchtungsplanung, sondern ermöglicht auch die Optimierung des fortlaufenden kommunalen Beleuchtungsmanagements.
Phase 3: Planung und Modellierung des SOLL-Zustands
Liegen Karte, Kataster und Straßenklassierung vollständig vor, kann in der finalen Phase – entweder auf Basis der DIN EN 13 201 oder auf Basis unserer eigenen oder kommunaler Richtwerte – mit der eigentlichen Beleuchtungsplanung begonnen werden. Hierfür werden die Straßen dreidimensional in DIALux nachempfunden, wobei man zwischen einfachen Simulationen (nur Straße und Leuchten) und komplexeren Simulationen (mit Gebäuden, Fahrzeugen etc.) unterscheiden kann, die manchmal im Sinne der besseren Visualisierung (Wiedererkennungswert) vorteilhaft sein können, deren Erstellung natürlich aber auch mit einem erhöhten Aufwand verbunden ist.
Mit diesen Simulationen kann nun der Einsatz verschiedener Leuchten virtuell getestet werden, wobei sich eine Vielzahl an Lösungen im Hinblick auf den Erfüllungsgrad der DIN EN 13 201, Energieverbrauch und laufende Kosten sowie die optische „Gefälligkeit“ von Lampenköpfen und Lichtfarben hin bewerten und vergleichen lässt. Dabei sind wir bei HarzOptics nicht allein auf die von diversen Herstellern über die Suchmaschine Lumsearch der DIAL GmbH kostenfrei zur Verfügung gestellten Lampendaten angewiesen, sondern können mit Hilfe eines selbstentwickelten Photogoniometers auch beliebige Lampen selbst einmessen und in DIALux übertragen.
Im Ergebnis erhält die Kommune das Lichtpunktkataster, die GIS-Layer einschließlich der Lichtpunktkarte sowie die DIALux-Simulationen zusammen mit einem ausführlichen Bericht, in dem verschiedene mögliche Beleuchtungsszenarien auf ihre Eignung im Hinblick auf
– die Erfüllung der DIN EN 13 201 (oder anderer Vorgaben),
– ihre Wirtschaftlichkeit (Investitionskosten, laufende Kosten, Amortisation),
– ihre ökologische Verträglichkeit (Insektenverträglichkeit, Energieverbrauch, Lichtsmog) sowie
– zusätzliche Kriterien (Attraktivität von Lampenköpfen, Vorzugsverträge mit Herstellern etc. pp.)
geprüft und bewertet werden. Je nach Gewichtung der verschiedenen Kriterien ergibt sich am Ende eine Empfehlung für eine oder mehrere gleichwertige Beleuchtungskonfigurationen samt Wartungs-, Finanzierungs-, Amortisations- und Abschreibungsplanung. Sehr gerne stellen wir solche Beleuchtungskonzepte natürlich auch in Stadträten, Ratsausschüssen und Verwaltungsdezernaten vor – ich persönlich natürlich besonders gerne dann, wenn die ökologische Verträglichkeit und insbesondere die Lichtverschmutzung mit einer angemessenen Gewichtung im Entscheidungsfindungsprozess berücksichtigt werden konnten…
Zum Abschluss noch ein Wort zur DIN EN 13 201: Obwohl recht breit etabliert, wird die Norm seit Jahren von Umweltschützern und Astronomen aufgrund der empfohlenen Beleuchtungsstärken kritisiert. Tatsächlich haben wir in den vergangenen Jahren schon bei mehreren Lichtpunkterfassungen feststellen können, dass die durch die DIN vorgegebenen Lichtstärken durch die vorhandene Straßenbeleuchtung deutlich unterschritten werden – und das ganz offenbar ohne dass es dadurch je zu irgendwelchen Problemen gekommen oder die Beleuchtung durch die Anwohnerinnen und Anwohner auch nur als „zu schwach“ empfunden worden wäre. Es ist daher zu beachten, dass es sich bei der DIN EN 13 201 – wie auch bei jeder anderen DIN – lediglich um eine technische Empfehlung, nicht jedoch um eine gesetztliche Vorgabe handelt, die unbedingt in allen Punkten erfüllt werden muss. Aus diesem Grund bieten wir Kommunen neben der Entwicklung einer SOLL-Planung auf Basis der DIN EN 13 201 stets auch die Aufstellung einer SOLL-Planung mit geringerem Beleuchtungsniveau an. Es liegt dann in der Hand der Kommune (oder des Stadtrates) zu entscheiden, ob der Erfüllung der Norm oder der Optimierung von Energieefizienz und Umweltverträglichkeit Vorrang eingeräumt werden soll.





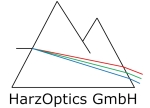
Danke für die tolle Darstellung, sehr bereichernd und interessant.
Verfasst von AdPoint GmbH | 18. März 2019, 10:59